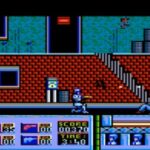Der Ohio Scientific Challenger II, meist kurz C2 genannt, erschien zwischen 1977 und 1979 als konsequente Weiterentwicklung der populären Superboard-Serie des US-amerikanischen Herstellers Ohio Scientific Instruments (OSI). Das Unternehmen, gegründet 1975 im Bundesstaat Ohio durch den Ingenieur Michael Cheiky, seine Frau Charity Cheiky sowie den Techniker Dale A. Dreisbach, hatte sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, aber leistungsfähige Mikrocomputersysteme mit professionellem Anspruch zu entwickeln – eine Philosophie, die sich im C2 deutlich widerspiegelt.
Der Ohio Scientific Challenger II, meist kurz C2 genannt, erschien zwischen 1977 und 1979 als konsequente Weiterentwicklung der populären Superboard-Serie des US-amerikanischen Herstellers Ohio Scientific Instruments (OSI). Das Unternehmen, gegründet 1975 im Bundesstaat Ohio durch den Ingenieur Michael Cheiky, seine Frau Charity Cheiky sowie den Techniker Dale A. Dreisbach, hatte sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, aber leistungsfähige Mikrocomputersysteme mit professionellem Anspruch zu entwickeln – eine Philosophie, die sich im C2 deutlich widerspiegelt.
Der C2 war kein typischer Heimcomputer, sondern vielmehr ein modulares, aufrüstbares System, das sich vor allem an Entwickler, Ingenieure, Bildungseinrichtungen und kleine Unternehmen richtete. Die Gerätefamilie umfasste unter anderem den C2-4P, ein kompaktes, tragbares System mit vier internen Steckplätzen, sowie den C2-8P, der über acht Erweiterungssteckplätze verfügte und in einem größeren Gehäuse untergebracht war. Beide Modelle basierten auf einer steckkartenbasierten Architektur, bei der CPU, Video-Einheit, RAM und I/O als separate Platinen in einen Busrahmen („Backplane“) eingebunden wurden. Dies erlaubte eine bemerkenswerte Flexibilität und Erweiterbarkeit – Merkmale, die zu dieser Zeit noch keineswegs selbstverständlich waren.
Als Prozessor kam der bewährte MOS Technology 6502 mit einem Takt von 1 MHz zum Einsatz. Die Taktfrequenz wurde allerdings nicht, wie bei den meisten Konkurrenten, durch einen Quarzoszillator erzeugt, sondern durch einen programmierbaren 74LS123-Monoflop-Schaltkreis, was eine gewisse Variabilität und Feinjustierung ermöglichte. Der 6502 war ein 8-Bit-Prozessor mit einem einfachen, aber effizienten Befehlssatz, der unter anderem durch seine indizierten Adressierungsmodi und seine niedrige Chip-Komplexität überzeugte. In Kombination mit dem leichtgewichtigen Systemdesign bot dies eine für die damalige Zeit bemerkenswert hohe Rechenleistung pro investiertem Dollar.
Das Betriebssystem bestand typischerweise aus einem im ROM untergebrachten Monitorprogramm und einem einfachen BASIC-Interpreter, der in einer auf 8 KB reduzierten Form implementiert war. Von Diskette konnte ein rudimentäres OSI-DOS oder ein erweitertes BASIC geladen werden. Der Zugriff erfolgte über einen simplen Konsolenmodus mit Cursorkontrolle und hexadezimalem Direktzugriff auf Speicheradressen. Auf dem Bildschirm konnten maximal 64 Zeichen pro Zeile bei 32 Zeilen dargestellt werden, wobei ausschließlich monochrome Textausgabe unterstützt wurde. Eine Bitmap-Grafikfähigkeit war serienmäßig nicht vorhanden, konnte aber theoretisch über Zusatzhardware realisiert werden. Farbdarstellung war nicht vorgesehen – der C2 blieb in dieser Hinsicht der kompromisslosen Funktionalität verpflichtet.
Auch in Sachen Klanggestaltung herrschte Sparsamkeit. Der C2 besaß keinen dedizierten Soundchip. Audioausgabe war nur indirekt über den Kansas City Standard möglich – einem Codierformat für Audiodaten, das auf Kassette gespeichert wurde. Manche Nutzer zweckentfremdeten das Kassetteninterface für primitive Tonausgabe, doch echte Musik- oder Effektfähigkeiten fehlten vollständig.
Der Massenspeicher bestand standardmäßig aus einem Kassettenrekorder-Anschluss, der mit 300 bis 1200 Baud arbeitete. Gegen Aufpreis konnte das System um ein Floppy-Interface (Model 470) ergänzt werden. Hier kamen wahlweise 5¼-Zoll- oder 8-Zoll-Laufwerke zum Einsatz. In seltenen Fällen wurde sogar ein Festplattenanschluss für Winchester-Laufwerke implementiert – eine für die späten 1970er geradezu futuristische Option. Der interne Arbeitsspeicher konnte von 4 KB (auf der CPU-Karte) auf bis zu 64 KB aufgerüstet werden, was für komplexe BASIC-Programme oder datenintensive Anwendungen absolut notwendig war.
In puncto Peripherie war der C2 ausgesprochen vielseitig. Neben parallelen und seriellen I/O-Karten bot OSI auch Druckerschnittstellen, einen Terminalanschluss, eine Mehrprozessor-Karte (Model 460Z) sowie diverse RAM-Erweiterungsplatinen an. Eine geplante Sprachsyntheseeinheit wurde angekündigt, aber nie über das Prototypstadium hinaus realisiert. Die Tastatur war separat im Gehäuse verbaut und erinnerte in Aufbau und Haptik eher an industrielle Terminals als an Heimcomputer-Tastaturen.
Die physische Größe variierte je nach Modell: Der C2-4P maß etwa 40 × 30 × 15 cm, der C2-8P war nochmals größer und erforderte einen separaten Monitor und häufig eine externe Stromversorgung. Das Design war funktional, industriell, kantig – und entsprach damit ganz dem technologischen Ethos der späten 1970er.
Die Preise für den Ohio Scientific C2 begannen 1978 bei 598 US-Dollar für das C2-4P-System. Das C2-8P schlug mit rund 799 US-Dollar zu Buche. Inflationsbereinigt entspricht dies im Jahr 2025 etwa 3.500 bis 4.700 Euro, je nach Modell und Ausstattung. Verglichen mit einem Apple II, der damals weit über 1.200 Dollar kostete, war der C2 also ein attraktives Angebot für technisch versierte Nutzer mit professionellen Ansprüchen. In der Fachpresse wurde der C2 teils wohlwollend, teils kritisch besprochen. Das Magazin Kilobaud lobte ihn als „beispiellose modulare Plattform für ernsthafte Computeranwender“, während Byte die Integration und Modularität herausstellte, jedoch die fehlende Farbgrafik bemängelte. Die Nachrichtenagentur UPI schrieb 1978: „Ein portabler Computer mit Fähigkeiten, die man sonst nur von Minis kennt.“
Die Verkaufszahlen lassen sich heute nur grob abschätzen. Bekannt ist, dass Ohio Scientific 1979 etwa 18 Millionen Dollar Umsatz erzielte und rund 300 Mitarbeiter beschäftigte. Der C2 war vor allem in Universitäten, Forschungseinrichtungen und kleinen Industriebetrieben zu finden – seltener im privaten Gebrauch. Sein modularer Aufbau, seine Erweiterbarkeit und seine offene Architektur machten ihn beliebt bei Bastlern, doch die lange Lieferzeiten und das Fehlen eines größeren Software-Ökosystems verhinderten eine breitere Marktdurchdringung. Im Vergleich zum Vorgänger, dem populären Superboard II, bot der C2 eine erheblich professionellere Bauweise, bessere Erweiterungsmöglichkeiten und eine robuste Backplane-Struktur. Gegenüber Konkurrenten wie dem Apple II, dem Commodore PET oder dem TRS-80 konnte er technisch mithalten, doch fehlten ihm ein attraktives Gehäuse, Farbfähigkeit und der Zugang zu einer großen Entwicklergemeinde – Punkte, die für Endanwender immer entscheidender wurden.
Trotzdem bleibt der Ohio Scientific C2 ein Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte des Mikrocomputers. Er verkörpert jene Zwischenphase, in der sich die Heimcomputertechnik von der Garagenbastelei zur ernsthaften Computertechnik emanzipierte. Die Entwickler Michael und Charity Cheiky sowie Dale Dreisbach waren Pioniere, deren Beitrag zum frühen Mikrocomputermarkt in Fachkreisen heute mit Respekt betrachtet wird. Obwohl Ohio Scientific in den frühen 1980er Jahren schließlich von der Firma M/A-COM übernommen wurde und der Markenname verschwand, lebt der C2 in Sammlerkreisen fort – nicht zuletzt als Symbol für eine Ära, in der technische Eleganz und logisches Design noch mehr zählten als bunte Grafiken und Geräuschkulissen.




 Wenn ich Dich, werter Leser, fragen würde, ob Du irgendwann einmal in Deinem Leben ein Programm ohne Zustimmung des Urhebers kopiert hast, würdest Du wahrscheinlich mit einem verlegenen Lächeln zustimmen, denn höchstwahrscheinlich hast Du die Zeit miterlebt und möglicherweise dank Programmen wie bspw. X-Copy auf dem Amiga ausgiebig davon Gebrauch gemacht (Nur zur Beruhigung: die Verjährungsfrist ist hier schon längst vorbei). Das nicht nur der private Heimanwender sich das Leben etwas vereinfachen wollte, ist daraus sicherlich erklärlich und beruhte auch auf der Tatsache, dass es noch bis Anfang der 1980er keine wirklichen Präzedenzfälle existierten. Dies sah auch der US-amerikanische Hersteller Franklin Computer Corporation so und präsentierte 1982 die ACE Modellreihe, die absolut Apple II kompatibel waren.
Wenn ich Dich, werter Leser, fragen würde, ob Du irgendwann einmal in Deinem Leben ein Programm ohne Zustimmung des Urhebers kopiert hast, würdest Du wahrscheinlich mit einem verlegenen Lächeln zustimmen, denn höchstwahrscheinlich hast Du die Zeit miterlebt und möglicherweise dank Programmen wie bspw. X-Copy auf dem Amiga ausgiebig davon Gebrauch gemacht (Nur zur Beruhigung: die Verjährungsfrist ist hier schon längst vorbei). Das nicht nur der private Heimanwender sich das Leben etwas vereinfachen wollte, ist daraus sicherlich erklärlich und beruhte auch auf der Tatsache, dass es noch bis Anfang der 1980er keine wirklichen Präzedenzfälle existierten. Dies sah auch der US-amerikanische Hersteller Franklin Computer Corporation so und präsentierte 1982 die ACE Modellreihe, die absolut Apple II kompatibel waren. Der Archimedes A7000 war einer der letzten klassischen Computer von Acorn Computers Ltd., jener traditionsreichen britischen Firma, die sich bereits in den 1980er Jahren mit ihren innovativen BBC-Mikrocomputern und der Einführung des RISC-Konzepts als Pionier auf dem Heimcomputermarkt etablierte. Der A7000 wurde im Juli 1995 vorgestellt und markierte den Versuch, ein erschwingliches und zugleich leistungsfähiges Modell für den Bildungsbereich und ambitionierte Heimnutzer anzubieten, das die Tugenden seiner Vorgänger mit moderneren Bauteilen verband. Während der A7000 äußerlich kompakter wirkte, verbarg sich unter seinem schlichten grauen Kunststoffgehäuse ein System, das auf RISC OS 3.6 lief und in vielerlei Hinsicht den Brückenschlag zwischen der alten Archimedes-Reihe und den späteren RiscPCs darstellte.
Der Archimedes A7000 war einer der letzten klassischen Computer von Acorn Computers Ltd., jener traditionsreichen britischen Firma, die sich bereits in den 1980er Jahren mit ihren innovativen BBC-Mikrocomputern und der Einführung des RISC-Konzepts als Pionier auf dem Heimcomputermarkt etablierte. Der A7000 wurde im Juli 1995 vorgestellt und markierte den Versuch, ein erschwingliches und zugleich leistungsfähiges Modell für den Bildungsbereich und ambitionierte Heimnutzer anzubieten, das die Tugenden seiner Vorgänger mit moderneren Bauteilen verband. Während der A7000 äußerlich kompakter wirkte, verbarg sich unter seinem schlichten grauen Kunststoffgehäuse ein System, das auf RISC OS 3.6 lief und in vielerlei Hinsicht den Brückenschlag zwischen der alten Archimedes-Reihe und den späteren RiscPCs darstellte. Der Yashica YC 64 wurde 1984 von Kyocera unter der Marke Yashica als MSX 1 Heimcomputer auf den europäischen Markt gebracht und erschien Ende 1985 offiziell auch in Frankreich . Sein Gehäuse in ungewöhnlichem Rotbraun stach sofort ins Auge – eine bewusst jugendfreundliche Designentscheidung, die ihn von anderen MSX Geräten abhob. Der Preis lag bei etwa 950 DM (rund 798 DM laut MSX Wiki für Deutschland). Umgerechnet und inflationsbereinigt entspräche das heute etwa 400–450 €, was ihn als gehobene Mittelklasse positionierte. Der MSX-Standard versprach einheitliche Kompatibilität, einen großen Softwarepool und internationale Anschlussfähigkeit – ein attraktives Feld für Firmen, die bislang mit Computern wenig zu tun hatten. In Deutschland stellte das Magazin Happy Computer fest : „Wer ›nur‹ ein MSX Gerät ohne Schnörkel und mit viel Speicher sucht, ist mit dem YC 64 ausreichend bedient“
Der Yashica YC 64 wurde 1984 von Kyocera unter der Marke Yashica als MSX 1 Heimcomputer auf den europäischen Markt gebracht und erschien Ende 1985 offiziell auch in Frankreich . Sein Gehäuse in ungewöhnlichem Rotbraun stach sofort ins Auge – eine bewusst jugendfreundliche Designentscheidung, die ihn von anderen MSX Geräten abhob. Der Preis lag bei etwa 950 DM (rund 798 DM laut MSX Wiki für Deutschland). Umgerechnet und inflationsbereinigt entspräche das heute etwa 400–450 €, was ihn als gehobene Mittelklasse positionierte. Der MSX-Standard versprach einheitliche Kompatibilität, einen großen Softwarepool und internationale Anschlussfähigkeit – ein attraktives Feld für Firmen, die bislang mit Computern wenig zu tun hatten. In Deutschland stellte das Magazin Happy Computer fest : „Wer ›nur‹ ein MSX Gerät ohne Schnörkel und mit viel Speicher sucht, ist mit dem YC 64 ausreichend bedient“ Der Lucas Nascom 1 war ein britischer Einplatinen-Computerbausatz, der im November 1977 eingeführt wurde. Die grundsätzliche Entwicklungs-Idee kam ursprünglich von einer US-amerikanischen Firma namens Nasco, die jedoch speziell an den englischen Markt dachte, als sie mit John Marshall und Kerr Borland von Nascom Microcomputers kooperierte. Entwickelt wurde er schließlich von Chris Shelton, dessen Ziel es war, einen erschwinglichen Computer für Elektronikbegeisterte zu schaffen. Mit einem Preis von £197,50 (inflationsbereinigt etwa 1.590 € im Jahr 2025) war der Nascom 1 deutlich günstiger als zeitgenössische Modelle wie der Commodore PET oder der Apple II. Das Herzstück des Nascom 1 war ein Zilog
Der Lucas Nascom 1 war ein britischer Einplatinen-Computerbausatz, der im November 1977 eingeführt wurde. Die grundsätzliche Entwicklungs-Idee kam ursprünglich von einer US-amerikanischen Firma namens Nasco, die jedoch speziell an den englischen Markt dachte, als sie mit John Marshall und Kerr Borland von Nascom Microcomputers kooperierte. Entwickelt wurde er schließlich von Chris Shelton, dessen Ziel es war, einen erschwinglichen Computer für Elektronikbegeisterte zu schaffen. Mit einem Preis von £197,50 (inflationsbereinigt etwa 1.590 € im Jahr 2025) war der Nascom 1 deutlich günstiger als zeitgenössische Modelle wie der Commodore PET oder der Apple II. Das Herzstück des Nascom 1 war ein Zilog  Der Fujitsu FM-7, auch bekannt als „Fujitsu Micro 7“, wurde im November 1982 als kostengünstiger Heimcomputer eingeführt und war eine vereinfachte Version des
Der Fujitsu FM-7, auch bekannt als „Fujitsu Micro 7“, wurde im November 1982 als kostengünstiger Heimcomputer eingeführt und war eine vereinfachte Version des  Als Apple im Mai 1980 den Apple III vorstellte, galt er als ambitioniertes Vorhaben, das den erfolgreichen Apple II beerben und das Unternehmen aus dem Heimcomputersegment in den lukrativeren Markt für Business-Computer führen sollte. Die Erwartungen waren immens, denn Apple hatte sich mit dem Apple II als führender Hersteller in der Bildungs- und Hobbyszene etabliert, doch um Unternehmen wie IBM und DEC herauszufordern, musste ein professionelleres Gerät entstehen – leistungsfähiger, robuster und mit echtem Betriebssystem. Der Apple III wurde somit von Anfang an als Business-Maschine positioniert, mit höherem Arbeitsspeicher, besseren Textdarstellungsfähigkeiten und einem professionelleren Gehäuse. Doch die Realität entwickelte sich anders: Der Apple III wurde später berüchtigt als eines der größten Technikdesaster der frühen Computerindustrie.
Als Apple im Mai 1980 den Apple III vorstellte, galt er als ambitioniertes Vorhaben, das den erfolgreichen Apple II beerben und das Unternehmen aus dem Heimcomputersegment in den lukrativeren Markt für Business-Computer führen sollte. Die Erwartungen waren immens, denn Apple hatte sich mit dem Apple II als führender Hersteller in der Bildungs- und Hobbyszene etabliert, doch um Unternehmen wie IBM und DEC herauszufordern, musste ein professionelleres Gerät entstehen – leistungsfähiger, robuster und mit echtem Betriebssystem. Der Apple III wurde somit von Anfang an als Business-Maschine positioniert, mit höherem Arbeitsspeicher, besseren Textdarstellungsfähigkeiten und einem professionelleren Gehäuse. Doch die Realität entwickelte sich anders: Der Apple III wurde später berüchtigt als eines der größten Technikdesaster der frühen Computerindustrie. Als der Amstrad CPC 464+ im Jahr 1990 auf den Markt kam, war der Heimcomputermarkt bereits im Umbruch. 16-Bit-Maschinen wie der Commodore Amiga 500 und der Atari ST hatten längst die Fantasie der Entwickler und Spieler erobert, und der klassische 8-Bit-Markt schrumpfte rapide. Dennoch entschloss sich Amstrad unter der Leitung von Sir Alan Sugar dazu, der erfolgreichen CPC-Reihe ein letztes, modernisiertes Update zu verpassen – als Teil einer neuen Generation von Produkten, die mit dem GX4000-Spielsystem eine gemeinsame Hardwarebasis teilen sollten. Der CPC 464+ wurde als direkter Nachfolger des beliebten
Als der Amstrad CPC 464+ im Jahr 1990 auf den Markt kam, war der Heimcomputermarkt bereits im Umbruch. 16-Bit-Maschinen wie der Commodore Amiga 500 und der Atari ST hatten längst die Fantasie der Entwickler und Spieler erobert, und der klassische 8-Bit-Markt schrumpfte rapide. Dennoch entschloss sich Amstrad unter der Leitung von Sir Alan Sugar dazu, der erfolgreichen CPC-Reihe ein letztes, modernisiertes Update zu verpassen – als Teil einer neuen Generation von Produkten, die mit dem GX4000-Spielsystem eine gemeinsame Hardwarebasis teilen sollten. Der CPC 464+ wurde als direkter Nachfolger des beliebten  Der Amstrad CPC (Colour Personal Computer), eine Heimcomputer-Serie aus Großbritannien, wurde 1984 von Amstrad unter der Leitung von Alan Michael Sugar veröffentlicht. Die Serie war Amstrads Antwort auf die Dominanz von Commodore, Sinclair und Acorn im britischen Heimcomputermarkt der frühen 1980er Jahre. Sugar, ein britischer Unternehmer aus einfachen Verhältnissen, hatte sich bis dahin mit billigen Stereoanlagen und Haushaltsgeräten einen Namen gemacht. Mit dem CPC wollte er in den expandierenden Heimcomputermarkt einsteigen, allerdings mit einer radikal anderen Herangehensweise: statt einem nackten Motherboard wie beim Sinclair
Der Amstrad CPC (Colour Personal Computer), eine Heimcomputer-Serie aus Großbritannien, wurde 1984 von Amstrad unter der Leitung von Alan Michael Sugar veröffentlicht. Die Serie war Amstrads Antwort auf die Dominanz von Commodore, Sinclair und Acorn im britischen Heimcomputermarkt der frühen 1980er Jahre. Sugar, ein britischer Unternehmer aus einfachen Verhältnissen, hatte sich bis dahin mit billigen Stereoanlagen und Haushaltsgeräten einen Namen gemacht. Mit dem CPC wollte er in den expandierenden Heimcomputermarkt einsteigen, allerdings mit einer radikal anderen Herangehensweise: statt einem nackten Motherboard wie beim Sinclair