Heart of Africa - 1985 by Ozark Softscape / EA
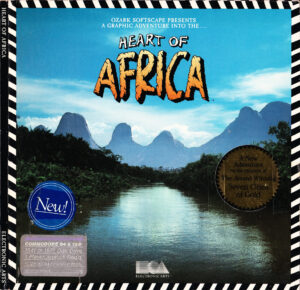 Heart of Africa erschien 1985 exklusiv für den Commodore 64 und war der inoffizielle Nachfolger von The Seven Cities of Gold. Entwickelt wurde es von Dan Bunten, später Danielle Bunten Berry, gemeinsam mit Ozark Softscape, produziert von Joe Ybarra bei Electronic Arts und in Deutschland von Ariolasoft veröffentlicht. Schon die Aufmachung war ein Blickfang: eine großformatige Box im LP-Stil, ein beigefügtes Handbuch in Form eines Tagebuchs, eine Afrika-Karte zum Miträtseln – und auf dem Cover posierte Bunten im Safari-Outfit. Electronic Arts behandelte seine Designer damals wie Popstars, was sich auch in dieser Präsentation widerspiegelte.
Heart of Africa erschien 1985 exklusiv für den Commodore 64 und war der inoffizielle Nachfolger von The Seven Cities of Gold. Entwickelt wurde es von Dan Bunten, später Danielle Bunten Berry, gemeinsam mit Ozark Softscape, produziert von Joe Ybarra bei Electronic Arts und in Deutschland von Ariolasoft veröffentlicht. Schon die Aufmachung war ein Blickfang: eine großformatige Box im LP-Stil, ein beigefügtes Handbuch in Form eines Tagebuchs, eine Afrika-Karte zum Miträtseln – und auf dem Cover posierte Bunten im Safari-Outfit. Electronic Arts behandelte seine Designer damals wie Popstars, was sich auch in dieser Präsentation widerspiegelte.
Das Spiel versetzt den Spieler ins Jahr 1890. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Forschers Hiram Primm wird ein britischer Abenteurer damit beauftragt, das Grab des Pharaos „Ahnk Ahnk“ zu finden. Ausgestattet mit minimalem Kapital und einem Tagebuch beginnt die Expedition in einem Hafen nahe Kairo. Von dort aus führt die Reise über den gesamten Kontinent, durch Wüsten, Savannen und Regenwälder, vorbei an Orten wie Timbuktu oder den Nilquellen. Ziel war es, Hinweise der einheimischen Stämme zu erlangen, Schätze zu bergen und am Ende das Herz von Afrika aufzuspüren. Die Spielfigur wird in Vogelperspektive gesteuert, mit Joystick und komfortablen Automapping sowie einem automatisch geführten Tagebuch. Damit unterschied es sich wohltuend von anderen Abenteuerspielen der Zeit, bei denen man selbst Karten zeichnen musste.
Eine der größten Stärken lag im Umgang mit den Stämmen Afrikas. Sie reagierten sehr unterschiedlich: Ein Geschenk konnte Freundschaft stiften, ein unpassendes Mitbringsel beleidigen, Drohungen führten oft ins Verderben. Dieses System gab der Suche eine spannende soziale Dimension. „Man sollte sich fühlen wie ein richtiger Entdecker, der fremden Kulturen gegenübertritt“, erinnerte sich Bunten später. Dass das Spiel weniger koloniale Eroberung als vielmehr Schatzsuche thematisierte, war eine bewusste Abkehr vom Vorgänger. Ursprünglich hatte Bunten überlegt, die koloniale Aufteilung Afrikas spielerisch umzusetzen, stellte aber schnell fest, dass dieser Kontext nicht funktionierte. Er verwandelte das Szenario in ein Abenteuer à la King Solomon’s Mines – eine Entscheidung, die den Ton des Spiels grundlegend änderte.
Die Entwicklung dauerte etwa ein Jahr. Neben Bunten arbeiteten Alan Watson und Mark Botner als Programmierer. Watson, der schon bei M.U.L.E. und Seven Cities beteiligt war, steuerte die Grafik bei, während Bill Bunten die Tagebuchtexte verfasste. Den musikalischen Rahmen lieferte David Warhol, dessen minimalistische Titelmelodie die Einsamkeit des Abenteurers unterstrich. Während der Arbeit gab es Pläne für zusätzliche Mechaniken: eine erweiterte Handelskomponente, mehr Stadtleben oder eine dynamische Kartengenerierung wie beim Vorgänger. Diese Ideen scheiterten jedoch an den technischen Grenzen des C64. Bunten selbst sah später kritisch, dass die eingeführten Zufallselemente – wechselnde Grabstandorte und Schatzverstecke – zwar Abwechslung brachten, aber keine wirklich dichte Erzählung. „Es waren austauschbare Versatzstücke, nicht die große Geschichte“, meinte sie rückblickend.
 Veröffentlicht wurde das Spiel 1985 in den USA und 1986 in Europa. Ariolasoft legte besonderen Wert auf die deutsche Ausgabe Das Herz von Afrika, die vollständig übersetzt war – ein seltener Luxus Mitte der Achtziger. International wurde das Spiel von der Presse positiv aufgenommen. Compute! lobte es als „professionell in jeder Hinsicht“ und sogar süchtigmachender als den Vorgänger, Commodore User vergab 8 von 10 Punkten. In Deutschland schaffte es 1987 in einer Happy Computer-Leserumfrage immerhin auf Platz 16 der besten Spiele des Vorjahres. Kritiker hoben die Atmosphäre, die Mischung aus Strategie und Adventure sowie die Bedienbarkeit hervor, merkten aber an, dass die Karte Afrikas immer gleich blieb und das Spiel daher bei wiederholtem Durchspielen an Reiz verlieren konnte.
Veröffentlicht wurde das Spiel 1985 in den USA und 1986 in Europa. Ariolasoft legte besonderen Wert auf die deutsche Ausgabe Das Herz von Afrika, die vollständig übersetzt war – ein seltener Luxus Mitte der Achtziger. International wurde das Spiel von der Presse positiv aufgenommen. Compute! lobte es als „professionell in jeder Hinsicht“ und sogar süchtigmachender als den Vorgänger, Commodore User vergab 8 von 10 Punkten. In Deutschland schaffte es 1987 in einer Happy Computer-Leserumfrage immerhin auf Platz 16 der besten Spiele des Vorjahres. Kritiker hoben die Atmosphäre, die Mischung aus Strategie und Adventure sowie die Bedienbarkeit hervor, merkten aber an, dass die Karte Afrikas immer gleich blieb und das Spiel daher bei wiederholtem Durchspielen an Reiz verlieren konnte.
Kommerziell konnte es nicht an Seven Cities of Gold anknüpfen, das über 150.000 Einheiten verkauft hatte. Heart of Africa erreichte lediglich einen Bruchteil davon, vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Dennoch war es für Electronic Arts profitabel und blieb Buntens dritterfolgreichstes Werk. Damals kostete die C64-Version im Handel etwa £14,95 in Großbritannien, was inflationsbereinigt heute rund £55–60 entspricht, also gut 65–70 Euro. In den USA lag der Preis bei 25–30 Dollar, was nach heutiger Kaufkraft knapp 70 Dollar entspräche. Auf heutigen Sammlerplattformen wie eBay oder Foren schwanken die Preise stark. Unvollständige oder abgenutzte Exemplare bekommt man schon ab 20–25 Euro, während vollständige Boxen mit Karte und Handbuch zwischen 45 und 70 Euro liegen. Neuware in Folie oder seltene Versionen – etwa die deutsche Ariolasoft- oder die Atari-Fassung – erzielen durchaus 100 Euro oder mehr.
So bleibt Heart of Africa ein faszinierendes Produkt seiner Zeit. Für Bunten selbst war es ein Übergangswerk, das sie später ambivalent sah. Doch für viele Spieler ist es eine unvergessliche Expedition in ein Afrika voller Gefahren, Geheimnisse und Begegnungen – ein Spiel, das mit einfachen Mitteln eine Atmosphäre schuf, die bis heute nachhallt.

 Sirenen heulen auf und quietschende Reifen hallen durch eine isometrische Pixel-Stadt: Chicago 90 – ein ungewöhnliches Action-Rennspiel von Microïds aus dem Jahr 1989 – versetzte die Spieler mitten in eine virtuelle Verfolgungsjagd. Dabei ließ sich das französische Entwicklerteam zu einem augenzwinkernden Konzept inspirieren: Was wäre, wenn Pac-Man ein Fluchtauto wäre und die Geister Polizeiwagen? In Chicago 90 schlüpft man entweder in die Rolle eines Gangsters auf der Flucht oder übernimmt das Kommando der Polizei. Als Gangster gilt es, nach einem Bankraub die Stadtgrenzen zu erreichen, bevor die Polizei einen einkesselt. Als Polizeichef hingegen koordiniert man bis zu sechs Einsatzwagen, um den flüchtigen Ganoven zu stellen. Dieses duale Spielprinzip – Gangster gegen Gesetzeshüter – war 1989 erfrischend originell und sorgte für zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen innerhalb eines Spiels.
Sirenen heulen auf und quietschende Reifen hallen durch eine isometrische Pixel-Stadt: Chicago 90 – ein ungewöhnliches Action-Rennspiel von Microïds aus dem Jahr 1989 – versetzte die Spieler mitten in eine virtuelle Verfolgungsjagd. Dabei ließ sich das französische Entwicklerteam zu einem augenzwinkernden Konzept inspirieren: Was wäre, wenn Pac-Man ein Fluchtauto wäre und die Geister Polizeiwagen? In Chicago 90 schlüpft man entweder in die Rolle eines Gangsters auf der Flucht oder übernimmt das Kommando der Polizei. Als Gangster gilt es, nach einem Bankraub die Stadtgrenzen zu erreichen, bevor die Polizei einen einkesselt. Als Polizeichef hingegen koordiniert man bis zu sechs Einsatzwagen, um den flüchtigen Ganoven zu stellen. Dieses duale Spielprinzip – Gangster gegen Gesetzeshüter – war 1989 erfrischend originell und sorgte für zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen innerhalb eines Spiels.




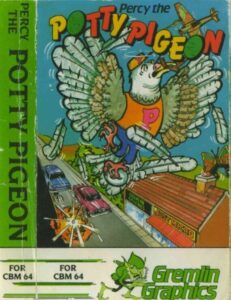 Percy the Potty Pigeon gehört zu jenen Spielen, die man im Regal kaum übersehen konnte – schon der Titel klingt wie ein pubertärer Scherz, und genau so fühlte es sich 1984 auch an. Gremlin Graphics war gerade dabei, aus einem kleinen Laden in Sheffield zu einem richtigen Softwarehaus zu werden, und man brauchte einen Erstling, der auffiel. Also schickte man nicht Raumschiffe oder Ritter ins Rennen, sondern eine Taube. „The first game where you are a bird!“ stand keck auf der Packung, und das britische Publikum wusste sofort, dass hier mit Augenzwinkern gearbeitet wurde.
Percy the Potty Pigeon gehört zu jenen Spielen, die man im Regal kaum übersehen konnte – schon der Titel klingt wie ein pubertärer Scherz, und genau so fühlte es sich 1984 auch an. Gremlin Graphics war gerade dabei, aus einem kleinen Laden in Sheffield zu einem richtigen Softwarehaus zu werden, und man brauchte einen Erstling, der auffiel. Also schickte man nicht Raumschiffe oder Ritter ins Rennen, sondern eine Taube. „The first game where you are a bird!“ stand keck auf der Packung, und das britische Publikum wusste sofort, dass hier mit Augenzwinkern gearbeitet wurde.





 B.C.’s Quest for Tires, entwickelt von Sydney Development Corporation und vertrieben durch Sierra On-Line, war eines jener Spiele, das im goldenen Zeitalter der Heimcomputer erschien und dabei etwas ganz Eigenes schuf. Basierend auf dem beliebten Zeitungscomic B.C. von Johnny Hart, versetzte das Spiel den Spieler in die Rolle des wortkargen Höhlenmenschen Thor, der auf einem Steinrad durch prähistorische Landschaften rollt, um seine Angebetete – „Cute Chick“ – aus den Fängen des Dinosauriers Gronk zu befreien. Die Handlung mag rudimentär wirken, doch der Witz, die stilisierte Grafik und das durchdachte Gameplay machten den Titel zu einem Klassiker jener frühen Homecomputer-Ära.
B.C.’s Quest for Tires, entwickelt von Sydney Development Corporation und vertrieben durch Sierra On-Line, war eines jener Spiele, das im goldenen Zeitalter der Heimcomputer erschien und dabei etwas ganz Eigenes schuf. Basierend auf dem beliebten Zeitungscomic B.C. von Johnny Hart, versetzte das Spiel den Spieler in die Rolle des wortkargen Höhlenmenschen Thor, der auf einem Steinrad durch prähistorische Landschaften rollt, um seine Angebetete – „Cute Chick“ – aus den Fängen des Dinosauriers Gronk zu befreien. Die Handlung mag rudimentär wirken, doch der Witz, die stilisierte Grafik und das durchdachte Gameplay machten den Titel zu einem Klassiker jener frühen Homecomputer-Ära.






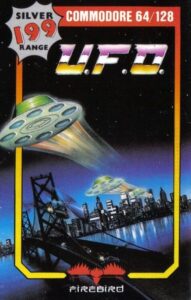 Im Jahr 1987 erschien im Rahmen von Firebirds berüchtigter „Silver Range“-Budgetserie ein Spiel, das auf den ersten Blick wie ein weiterer Space-Shooter wirkte, sich bei genauerem Hinsehen aber als technisches Kuriosum mit cleveren Detailideen entpuppte: U.F.O., entwickelt von Odin Computer Graphics für den Commodore 64, ein Spiel, das sich mit gerade einmal £1.99 in den Läden einsortierte, aber dennoch ein Stück Entwicklerhandwerk bewies, das über reines Massenfutter hinausragte – zumindest in der Theorie.
Im Jahr 1987 erschien im Rahmen von Firebirds berüchtigter „Silver Range“-Budgetserie ein Spiel, das auf den ersten Blick wie ein weiterer Space-Shooter wirkte, sich bei genauerem Hinsehen aber als technisches Kuriosum mit cleveren Detailideen entpuppte: U.F.O., entwickelt von Odin Computer Graphics für den Commodore 64, ein Spiel, das sich mit gerade einmal £1.99 in den Läden einsortierte, aber dennoch ein Stück Entwicklerhandwerk bewies, das über reines Massenfutter hinausragte – zumindest in der Theorie. Die Entwicklung fand unter knappen Budget- und Zeitrahmen statt. Laut einem nicht autorisierten Interview auf Spectrum Computing arbeitete das Team lediglich sechs Wochen an dem Titel. Eine geplante Version für den ZX Spectrum wurde verworfen – zu wenig Markt, zu hoher Portierungsaufwand für die dort fehlenden Hardwaresprites. Ursprünglich war U.F.O. als Teil einer Serie von Firebird-Budgettiteln geplant, die jeweils neue Spielmechaniken testen sollten. Ein Prototyp mit größerem Spielbereich und vertikaler Bewegung wurde zugunsten des Screen-by-Screen-Layouts gestrichen. Ebenso war eine Bosskampfsequenz in Planung, in der ein riesiges Mutterschiff über mehrere Bildschirme hinweg bekämpft werden sollte. Diese Phase wurde laut Entwicklernotizen aus Speichergründen verworfen – das Spiel nutzt nahezu die kompletten 64 KB des Commodore 64 aus.
Die Entwicklung fand unter knappen Budget- und Zeitrahmen statt. Laut einem nicht autorisierten Interview auf Spectrum Computing arbeitete das Team lediglich sechs Wochen an dem Titel. Eine geplante Version für den ZX Spectrum wurde verworfen – zu wenig Markt, zu hoher Portierungsaufwand für die dort fehlenden Hardwaresprites. Ursprünglich war U.F.O. als Teil einer Serie von Firebird-Budgettiteln geplant, die jeweils neue Spielmechaniken testen sollten. Ein Prototyp mit größerem Spielbereich und vertikaler Bewegung wurde zugunsten des Screen-by-Screen-Layouts gestrichen. Ebenso war eine Bosskampfsequenz in Planung, in der ein riesiges Mutterschiff über mehrere Bildschirme hinweg bekämpft werden sollte. Diese Phase wurde laut Entwicklernotizen aus Speichergründen verworfen – das Spiel nutzt nahezu die kompletten 64 KB des Commodore 64 aus.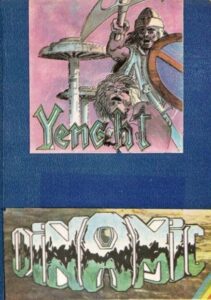 Als das spanische Softwarehaus Dinamic Software im Jahr 1984 das Spiel Yenght veröffentlichte, ahnte wohl niemand, dass man gerade Zeuge des ersten vollständig in Spanien entwickelten Text-Adventures wurde. Geschrieben in BASIC für den ZX Spectrum, war es nicht nur ein programmiertechnisches Abenteuer, sondern auch ein symbolischer Schritt in eine Zeit, in der Spaniens Spieleindustrie noch in den Kinderschuhen steckte – aber ordentlich lospolterte.
Als das spanische Softwarehaus Dinamic Software im Jahr 1984 das Spiel Yenght veröffentlichte, ahnte wohl niemand, dass man gerade Zeuge des ersten vollständig in Spanien entwickelten Text-Adventures wurde. Geschrieben in BASIC für den ZX Spectrum, war es nicht nur ein programmiertechnisches Abenteuer, sondern auch ein symbolischer Schritt in eine Zeit, in der Spaniens Spieleindustrie noch in den Kinderschuhen steckte – aber ordentlich lospolterte.

 Chimera (1985) von Firebird Software ist ein isometrisches Action-Adventure mit Science-Fiction-Flair – man steuert einen einsamen Astronauten in den Korridoren eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das gerade dabei ist, die Erde zu grillen. Das Ziel ist klassisch, aber effektvoll: Waffen außer Gefecht setzen, vier Selbstzerstörungsmodi aktivieren und abhaun, bevor alles in die Luft fliegt. Entwickelt hat das Ganze Shahid Ahmad, der zwar nicht am Ursprungswerk Jet Set Willy beteiligt war, aber die knifflige Aufgabe übernahm, das Spiel für den Commodore 64 zu konvertieren. Inspiriert durch Knight Lore, war Chimera sein erstes eigenes Projekt, das von Firebird zunächst abgelehnt, aber nach nur zwei Wochen Nachbesserung veröffentlicht wurde.
Chimera (1985) von Firebird Software ist ein isometrisches Action-Adventure mit Science-Fiction-Flair – man steuert einen einsamen Astronauten in den Korridoren eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das gerade dabei ist, die Erde zu grillen. Das Ziel ist klassisch, aber effektvoll: Waffen außer Gefecht setzen, vier Selbstzerstörungsmodi aktivieren und abhaun, bevor alles in die Luft fliegt. Entwickelt hat das Ganze Shahid Ahmad, der zwar nicht am Ursprungswerk Jet Set Willy beteiligt war, aber die knifflige Aufgabe übernahm, das Spiel für den Commodore 64 zu konvertieren. Inspiriert durch Knight Lore, war Chimera sein erstes eigenes Projekt, das von Firebird zunächst abgelehnt, aber nach nur zwei Wochen Nachbesserung veröffentlicht wurde.



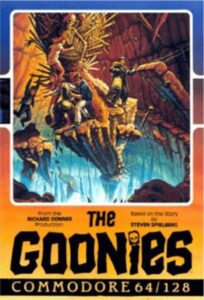 The Goonies, veröffentlicht 1985 in den USA von Datasoft und ein Jahr später in Europa von US Gold, war eine jener frühen Filmumsetzungen, die versuchten, das cineastische Abenteuerfeuerwerk ins pixelige 8‑Bit‑Universum zu übertragen – und das mit erstaunlich viel Charme, obwohl (oder gerade weil) man statt auf actionreiche Dauerballerei auf Puzzle-Kombinationen und Geschicklichkeit setzte. Das Spiel wurde von Scott Spanburg programmiert, der später noch durch Bruce Lee und Zorro auffiel, während Kelly Day die Grafik entwarf und Richard Mirsky (Apple II, Atari) sowie John A. Fitzpatrick (C64) sich um die Musik kümmerten – letztere teils mit eigenständigen Tape‑ und Diskettenversionen, was zur damaligen Zeit noch echte Unterschiede bedeutete.
The Goonies, veröffentlicht 1985 in den USA von Datasoft und ein Jahr später in Europa von US Gold, war eine jener frühen Filmumsetzungen, die versuchten, das cineastische Abenteuerfeuerwerk ins pixelige 8‑Bit‑Universum zu übertragen – und das mit erstaunlich viel Charme, obwohl (oder gerade weil) man statt auf actionreiche Dauerballerei auf Puzzle-Kombinationen und Geschicklichkeit setzte. Das Spiel wurde von Scott Spanburg programmiert, der später noch durch Bruce Lee und Zorro auffiel, während Kelly Day die Grafik entwarf und Richard Mirsky (Apple II, Atari) sowie John A. Fitzpatrick (C64) sich um die Musik kümmerten – letztere teils mit eigenständigen Tape‑ und Diskettenversionen, was zur damaligen Zeit noch echte Unterschiede bedeutete.




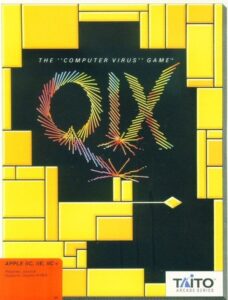 Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.
Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.










