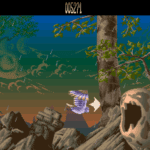Agony ist eines jener Spiele, bei denen man schon nach wenigen Sekunden spürt, dass hier etwas anderes im Gange ist. Nicht lauter, nicht schneller, nicht spektakulärer im herkömmlichen Sinne – sondern bewusster. Während sich Anfang der Neunziger unzählige horizontale Shooter gegenseitig mit Explosionen, Parallaxebenen und Dauerbeschuss zu übertrumpfen versuchten, wählte Agony einen anderen Weg. Es verlangsamte, verdichtete, ließ Raum. Und genau darin lag seine Wirkung.
Agony ist eines jener Spiele, bei denen man schon nach wenigen Sekunden spürt, dass hier etwas anderes im Gange ist. Nicht lauter, nicht schneller, nicht spektakulärer im herkömmlichen Sinne – sondern bewusster. Während sich Anfang der Neunziger unzählige horizontale Shooter gegenseitig mit Explosionen, Parallaxebenen und Dauerbeschuss zu übertrumpfen versuchten, wählte Agony einen anderen Weg. Es verlangsamte, verdichtete, ließ Raum. Und genau darin lag seine Wirkung.
Der Spieler steuert eine Eule – kein Raumschiff, keinen Kampfjet, kein futuristisches Vehikel –, sondern ein lebendiges Wesen, eingebettet in eine düstere, fremdartige Welt. Schon diese Entscheidung setzt den Ton. Agony will keine Machtfantasie sein, sondern eine Reise. Die Levels wirken wie organische Landschaften, oft mehr Traum als Ort, durchzogen von bizarren Formen, pulsierenden Strukturen und einer Bildsprache, die sich jeder klaren Genre-Zuordnung entzieht. Hier wird nicht gekämpft, um zu dominieren, sondern um zu überleben.
Das offizielle Handbuch verleiht dieser Welt eine deutlich tragischere Dimension. Es beschreibt Agony nicht als bloß abstrakte Fantasiewelt, sondern als Prüfung: Der mächtige Magier Acanthropsis entdeckt die sogenannte Cosmic Power und bezahlt diese Erkenntnis mit seinem Leben. Seine beiden Schüler Alestes und Mentor werden daraufhin gezwungen, sich einem tödlichen Wettstreit zu stellen, an dessen Ende nur einer überleben darf. Der Spieler übernimmt die Rolle von Alestes, verkörpert durch die Eule – nicht als Symbol der Weisheit, sondern als Prüfstein von Disziplin, Ausdauer und Kontrolle.
Entwickelt wurde das Spiel vom französischen Studio Art & Magic und veröffentlicht von Psygnosis, einem Label, das zu dieser Zeit wie kaum ein anderes für visuell und atmosphärisch ambitionierte Amiga-Produktionen stand. Die Programmierung lag in den Händen von Yves Grolet, dessen Arbeit entscheidend dafür war, dass Agony trotz seiner dichten Gestaltung stets kontrollierbar blieb. Technisch war das Spiel weniger Effektfeuerwerk als vielmehr Präzisionsarbeit. Die Grafik ist flüssig, reich an Details, ohne je unübersichtlich zu werden. Besonders auffällig ist die außergewöhnlich weiche Animation der Spielfigur, die Agony eine fast schwerelose Eleganz verleiht.
Das visuelle Erscheinungsbild geht maßgeblich auf Franck Sauer und Marc Albinet zurück. Ihre Arbeit verleiht der Spielwelt eine organische, fast lebendige Qualität, die sich deutlich von der klaren Maschinenästhetik vieler Zeitgenossen abhebt. Nicht zufällig orientiert sich die Wahl der Spielfigur an der ikonischen Eule aus dem Psygnosis-Firmenlogo – eine bewusste visuelle Selbstreferenz, die dem Spiel zusätzliche Identität verleiht. Die Levels fungieren nicht bloß als Kulisse, sondern als erzählerisches Element. Sie erzählen durch Formen, Farben und Bewegungen – leise, aber konsequent.
Eine zentrale Rolle spielt auch die Musik. Die In-Game-Kompositionen stammen von Jeroen Tel, während die Titelmusik unter Beteiligung von Tim Wright entstand. Ergänzt wird das akustische Gesamtbild durch Lade- und Endmusik, an der unter anderem Allister Brimble, Matthew Simmonds, Martin Iveson, Robert Ling und Martin Wall beteiligt waren. Die Musik treibt nicht an, sie bedrängt nicht, sondern zieht den Spieler tiefer hinein. Bild und Klang verschmelzen zu einer fast hypnotischen Einheit, die Agony weniger zu einem klassischen Shooter als zu einer atmosphärischen Erfahrung macht.
Spielmechanisch folgt Agony bekannten Regeln: Schießen, Ausweichen, Muster erkennen. Doch das Spiel bricht diese Regeln immer wieder subtil. Die Magie ist kein bloßer Schadensverstärker, sondern ein bewusst eingesetztes Werkzeug. Das Handbuch beschreibt ein System, bei dem Zauber zeitlich begrenzt sind und über ein Auswahlmenü aktiviert werden, solange die Feuertaste gehalten wird. Jeder Zauber erfüllt eine klar definierte taktische Funktion – von defensiven Schutzmechaniken bis hin zu kurzfristiger Raumkontrolle. Agony belohnt damit keine Reflexe, sondern Entscheidungen. Wer unüberlegt zaubert, steht kurze Zeit später schutzlos da.
Zeitgenössisch wurde Agony häufig als „ästhetischer Shooter“ beschrieben, manchmal bewundert, manchmal missverstanden. Wer schnelle Erfolgserlebnisse suchte, empfand es als zu langsam. Wer sich darauf einließ, erkannte seine Tiefe. Rückblickend wirkt das Spiel fast wie ein Gegenentwurf zu vielen seiner Zeitgenossen – weniger Produkt, mehr Ausdruck. Es will nicht beeindrucken, sondern wirken.
Ein geplanter Bestandteil dieser Wirkung fehlte jedoch in der finalen Version. Ursprünglich war für Agony eine animierte Intro-Sequenz vorgesehen, die das Szenario weiter ausgebaut hätte. Aufgrund der bereits voll ausgereizten Diskettenkapazität entschied man sich jedoch dagegen, zusätzliche Datenträger beizulegen. Das Intro wurde gestrichen – ein pragmatischer Kompromiss, der exemplarisch für die Produktionsrealität ambitionierter Amiga-Spiele jener Zeit steht.
Auch jenseits des Spiels selbst zeigt sich die Sorgfalt der Präsentation. Das markante Cover- und Logodesign stammt von Tony Roberts und Roger Dean, dessen Handschrift weit über die Spieleszene hinaus bekannt ist. Die Verbindung aus Spielgrafik, Musik und Verpackung verstärkte den Eindruck, dass Agony nicht als austauschbarer Shooter gedacht war, sondern als geschlossenes Werk.
Ein ungewöhnliches Nachleben erfuhr die Musik von Agony Mitte der 1990er Jahre außerhalb der Spieleszene. Die norwegische Black-Metal-Band Dimmu Borgir veröffentlichte 1996 auf ihrem Album Stormblåst mit dem Stück „Sorgens Kammer“ eine direkte Coverversion der Titelmelodie von Agony. Eine Nennung oder Genehmigung des ursprünglichen Komponisten erfolgte dabei zunächst nicht. Erst nach Kontaktaufnahme wurde der Titel in späteren Veröffentlichungen des Albums ersetzt.
Dass selbst das Handbuch mehr Wert auf Atmosphäre, Prüfung und Mythos als auf technische Selbstdarstellung legt, passt perfekt zu einem Spiel, das nie beeindrucken wollte, sondern wirken. Agony ist kein Spiel, das man beliebig wieder hervorholt. Es verlangt Stimmung, Zeit und Aufmerksamkeit. Aber wenn man sich darauf einlässt, entfaltet es eine Intensität, die auch Jahrzehnte später noch Bestand hat. Es ist kein Klassiker im lauten Sinne, kein Spiel der großen Gesten – sondern eines der leisen, nachhaltigen Eindrücke.